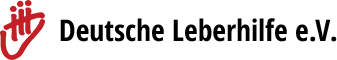Erfahrungen eines pflegenden Angehörigen
Mitte der neunziger Jahre veränderte sich unser Leben von einem auf den anderen Tag. Mein Freund kam vom Joggen und konnte das linke Augenlid nicht mehr ganz schließen. Die Augenärztin meinte, nichts Beunruhigendes. Nur zur Sicherheit sollte er in die MRT-Röhre. Wenig später eröffnete uns der Neurologe: ein Oligoastrozytom, ein bösartiger Hirntumor, Lebenszeit noch drei Monate. Wir arbeiteten damals beide in der Medienwelt, er als Screen Designer, ich als Creative Director. Unser Leben spielte sich auf der Überholspur ab. Das Wort „Deadline“ hatte für uns die Bedeutung: Termine halten, Tempo machen! Doch auf einmal bekam das Wort einen unerbittlichen existenziellen Ernst. Das Ende der Vorstellung nahte, der letzte Vorhang, der sich über die glitzernde Medienwelt senken sollte. Aber das Schicksal gewährte uns eine Frist.
1997 wurde ihm eine Leber transplantiert, der Hirntumor war fast vergessen, die verkündete „Deadline“ längst überschritten. Unsere Hoffnung klammerte sich nun an das neu gewonnene Leben. Nach zwei Nachoperationen an den Gallengängen und verschiedenen opportunistischen Infektionen ging es aufwärts, und das fühlte sich phantastisch an. Der Tumor verrichtete sein Zerstörungswerk währenddessen nahezu unbemerkt. Ganz in Ruhe ließ er uns trotzdem nicht. Wann würde das Ende kommen? Wie viel Aufschub würde uns noch vergönnt sein, wie viele gemeinsame Kinobesuche noch, wie viele Jogging-Runden im Stadtpark, wie oft noch zum Italiener um die Ecke? Der Schatten der „Deadline“, er wollte einfach nicht weichen. Erst einige Jahre später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Hirntumor um ein weniger aggressives Oligodendrogliom handelte. Im Rückblick betrachtet wirkte die Fehldiagnose wie eine Scheinhinrichtung. Ein Trauma, das mich vermutlich bis an mein Lebensende begleiten wird. Man kennt das aus Filmen oder Nachrichten über Terrorregime in entlegenen Weltgegenden: Eine Waffe wird in quälend langen Momenten auf jemand gerichtet, aber der Schuss geht nicht los. So etwa fühlte sich das für mich an. Nur dass die Situation nicht wenige Sekunden, sondern Jahre lang ungeklärt blieb.
Die Folgen der Transplantation rückten angesichts des Tumors bald in den Hintergrund. Wir hatten großes Glück, dass das Transplantat ideal „passte“. Außerdem fühlten und fühlen wir uns durch die Transplantations-Ambulanz unseres Krankenhauses optimal unterstützt. Auf die geballte medizinische Kompetenz eines erfahrenen Ärzteteams zurückgreifen zu können, ist ein wahrer Segen. Dennoch gab es auch Rückschläge. Neben den opportunistischen Infektionen in der Zeit unmittelbar nach der Transplantation traten des Öfteren Gallengangs-Infektionen, sog. Cholangitiden, auf. Die Fieberschübe, verbunden mit heftigen Schmerzen, versetzten mich mehr als einmal in Panik. Ich erspare es mir, auf die Details des Auf und Ab einzugehen, die sich infolge zwei so schwerwiegender Erkrankungen, wie mein Freund und heutiger Ehemann sie ertragen muss, zwangsläufig einstellen. Mir kommt es auf etwas Anderes an. Wie veränderte sich unser Leben dadurch? Wie geht die Gesellschaft mit pflegenden Angehörigen um?
Aus meiner Sicht leidet der Pflegesektor unter einer skandalösen Unterfinanzierung und Überbürokratisierung. Es würde zu weit führen, die Gründe dafür hier im Einzelnen darzulegen. Interessierten Lesern empfehle ich David Graebers Buch „Bullshit-Jobs.“ Graeber stellt das Koordinatensystem der Arbeitswelt auf den Kopf: Er zeigt mit praktischen Beispielen, dass Menschen, die aufopferungsvoll für und mit hilfsbedürftige(n) Menschen arbeiten, am wenigsten Anerkennung bekommen, am schlechtesten entlohnt werden und am meisten unter einer absurd ausufernden Bürokratie zu leiden haben. Aber genau dies sind die unverzichtbaren Jobs, ohne die die Gesellschaft von heute auf morgen kollabieren würde.
Da ich beide Enden des sozialen Spektrums kenne – das eines ehemals glänzend verdienenden Medien-Arbeiters und des an den Rand der Gesellschaft gedrängten pflegenden Angehörigen – fühle ich mich berechtigt, die soziale Schieflage genauer in den Blick zu nehmen. Mein Mann und ich leben seit mehreren Jahren von den Rücklagen, die fürs Alter gedacht waren. Bald werden sie aufgebraucht sein. Was dann? Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, denn ich muss funktionieren, anders geht es nicht. Deshalb habe ich mein Klavier verkauft: Ich brauchte dringend Geld, um mein Konto auszugleichen; Zeit zum Spielen habe ich sowieso schon lange nicht mehr. Die Pflegetätigkeit (Pflegegrad 4) ist ein Full-Time-Job. Ich bin rund um die Uhr im Einsatz, mein Radarsystem ist immer auf Empfang. Offen gestanden, so hart wie heute habe ich in der Glitzerwelt der Medien zu keiner Zeit gearbeitet.
Wie mir geht es vielen pflegenden Angehörigen. Nicht alle sind finanziell so gut gepolstert, dass sie sich osteuropäische Pflegekräfte leisten können, die, nebenbei bemerkt, in ihren Heimatländern von den eigenen Angehörigen oft schmerzlich vermisst werden. Irgendetwas kann an diesem System nicht stimmen: Gesellschaftlich dringend notwendige Tätigkeiten genießen das Ansehen von Freizeitbeschäftigungen und werden mit Geldbeträgen alimentiert, die hinten und vorn nicht reichen. Sie verdammen Menschen wie mich zur Altersarmut.
Zugleich beschäftigen sich Heerscharen von Menschen damit, den Pflegenotstand zu verwalten. In meinem Büro gibt es eine ganze Regalreihe mit Ordnern voller Anträge, Ablehnungen, Bescheide, Widersprüche, Bewilligungen, Vertröstungen, Informationsbroschüren et cetera . Der Papierkrieg hat sich zu einer veritablen Nebenbeschäftigung ausgeweitet. Dafür könnte ich gut und gern eine Büro-Hilfskraft beschäftigen, Job-Profil: „Kästchenankreuzer“. Wozu das Ganze? Wem dient es? Wem schadet es? Hat eigentlich mal jemand ausgerechnet, was dabei an Zeit, Geld und Energie draufgeht?
Begründungen für den Papierkrieg bedienen sich fast immer des Arguments, dass Leistungen anspruchsgerecht zugeteilt werden müssen. Das Verfahren gründet auf einem in der Gesellschaft tief verwurzelten Misstrauen. Es unterstellt den Anspruchsstellern aus Prinzip erst einmal, dass sie Leistungen unberechtigterweise „abzugreifen“ versuchen. Darin gleicht die Gesundheitsbürokratie der Hartz-4-Bürokratie. Hier wie dort werden Menschen gezwungen, intimste Details des Privatlebens offenzulegen, um die gewünschte Unterstützung zu bekommen. Nehmen wir als Beispiel die Logik der Pflegegrad-Bemessung. Das Verfahren behandelt erwachsene Menschen wie Schulkinder, denen man nicht über den Weg traut. Logischerweise werden diese mit allen erlaubten und unerlaubten Tricks versuchen, möglichst gute Noten zu ergattern versuchen. Wo Misstrauen herrscht, gibt es natürlich auch Trickser. Das folgt aus der Logik dieses Systems.
Die schlimmste Folge aber ist die Verschwendung von Zeit, Geld und Arbeitskraft für unproduktive Tätigkeiten. Dieser Makel haftet der Bürokratie seit jeher her an: Sie stellt selbst nichts her, sie entwickelt nichts Neues, und es wird von ihr auch niemand gepflegt. Sie reproduziert sich selbst und verfettet dabei immer mehr. Ein Drittel der heutigen Bürokratie müsste doch reichen, um die wirklich erforderliche Verwaltungsarbeit zu leisten. Das System ist irrsinnig aufgebläht. Es saugt bei allen Betroffenen massiv Geld und unwiederbringliche Lebenszeit ab. Zeit und Geld, die ich dringend benötige, um meinem geliebten Mann nach Kräften beizustehen. Unsere „Deadline“ rückt nämlich näher.
Wie es in mir aussieht? Ich empfinde die pflegende Tätigkeit als große Befriedigung und bin voller Optimismus. Das ist nicht nur so daher gesagt, es entspricht meinen innersten Überzeugungen. Doch mein Optimismus wird ausgebeutet. Wenn Sie mich fragen, wer für die Ausbeutung verantwortlich ist, so muss ich die Frage an die Politik zurückadressieren. Wir, die Angehörigen, sind „der größte Pflegedienstleister der Republik“, wie Wolfgang Stadler, Bundesvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt, sagt. (1) Aber wir verfügen über keine einflussreiche Lobby und Organisationsmacht. Wir sind die stummen Dulder eines Systems, das uns als nützliche Idioten missbraucht – tut mir leid, anders kann ich es nicht ausdrücken. Warum lassen wir das mit uns machen? Warum streiken wir nicht und sagen: Schluss, aus! Ich spiele nicht mehr mit. Die Antwort liegt auf der Hand: Dann müssten wir unsere Liebsten bestreiken, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Das tun wir natürlich nicht. Unsere Arbeit folgt anderen Regeln als die klassische Erwerbsarbeit. Wir haben keine Streik- und Kündigungsmöglichkeit, nicht einmal vertraglich festgelegte Arbeitszeiten. Uns fehlt die Möglichkeit, Druck mit Gegendruck zu beantworten. So sieht der Notstand in der häuslichen Pflegestation aus. Die Politik schaut zu und verbessert hier ein bisschen und da bisschen, nichts als Flickschusterei, die an den drückenden Nöten und Sorgen nichts ändert.
Name und Kontaktdaten des Autors sind der Redaktion bekannt.
- Vgl.: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/97948/Sozialverbaende-und-Gewerkschaften-warnen-vor-Nachteilen-fuer-pflegende-Rentner– Zugriff am 27.09.2018