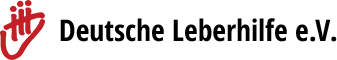Cholangiozelluläres Karzinom – Gallengangstumor
Anfang Januar 2021 erhielt ich die Diagnose eines intrahepatischen Cholangiozellulären Karzinoms (CCC, von cholangiocellular carcinoma). Dies ist ein sehr seltener Tumor in der Leber, ausgehend von den Zellen der Gallengänge, nicht von denen der Leber wie beim etwas bekannteren hepatozellulären Karzinom (HCC).
Wie hatte alles angefangen?
Etwa seit dem Spätsommer 2020 wachte ich immer mal wieder nachts auf, weil ich mittig im Oberbauch unterhalb des Brustbeins ein Druckgefühl, einen leichten Schmerz spürte. Schnell war ich aber immer wieder eingeschlafen, sodass ich am nächsten Morgen oft erst nachdenken musste, ob ich in der vergangenen Nacht dieses „komische“ Gefühl gehabt hatte. Im November war ich abends immer recht erschöpft, aber darüber berichteten auch KollegInnen – schließlich war durch Corona der Alltag nachhaltig verändert, man unternahm nichts mehr –, und auch mein Mann war müde und erschöpft.
Eines Tages, Ende November 2020, spürte ich rechts außen unter den Rippen im Laufe des Tages mehrfach sehr unangenehme bewegungsunabhängige Stiche. Noch am selben Tag konnte ich zu meinem Hausarzt kommen, der nach EKG und Ultraschall des Abdomens (Bauchraum) auf eine Gastritis tippte und entsprechende Medikation verordnete. Darunter konnte ich nicht wirklich eine Veränderung feststellen, sodass ich kurz vor Weihnachten eine Magenspiegelung durchführen ließ. Auch diese zeigte keinen richtungsweisenden Befund. Ich bat darum, dass der Gastroenterologe in seiner Praxis noch einmal eine Ultraschalluntersuchung durchführen möge, was aber wegen der bevorstehenden Feststage erst am ersten Öffnungstagen der Praxis nach dem Jahreswechsel möglich war.
In dieser Untersuchung konnte wiederum nichts Auffälliges festgestellt werden, sodass der Gastroenterologe meinte: „Naja, dann wird es auf die Verlegenheitsdiagnose „Reizmagen“ hinauslaufen.“ Kurz bevor er den Schallkopf wieder in die Halterung am Sonographie-Gerät zurückstellte, hielt er ihn noch einmal mittig auf den Bauch und sagte: „Hm, hier, da könnte etwas in der Leber sein.“ Er rief eine Kollegin hinzu, die bestätigte, dass dies die Leber sei. Dies sei abklärungsbedürftig, sodass der Arzt mir für den nächsten Tag einen MRT-Termin ausmachte.
Für diese Untersuchung musste ich zunächst ca. einen halben Liter eines extrem süßen dunkelroten Getränkes zu mir nehmen, bevor die MRT-Untersuchung mit intravenösem Kontrastmittel erfolgte. Wegen der Corona-Pandemie fand nicht direkt im Anschluss an die Untersuchung eine Besprechung mit der Radiologin/dem Radiologen statt, wie es bislang in der Praxis Usus gewesen war. Vielmehr sollte man angerufen werden. Immerhin bekam ich die Bilder der Untersuchung auf CD mit nach Hause. Schier endlos erschien mir das Warten – ein Anruf erfolgte über Stunden nicht.
Zwischenzeitlich war mein Mann, der Arzt ist, nach Hause gekommen und sah sich die Bilder auf der CD an. Den Moment, als er ins Wohnzimmer kam und mir sagte: „Das sieht nicht gut aus“, werde ich wohl nie vergessen. Nun versuchte er, in der Radiologie-Praxis endlich in Kontakt mit dem befundenden Kollegen zu kommen, was wiederum viel Zeit kostete. Nach gefühlten Ewigkeiten hatten wir schließlich eine Diagnose: Verdacht auf cholangiozelluläres Karzinom. Das sagte mir erst einmal nichts. Also fing ich die Befragung von „Dr. Google“ an, was mehr als niederschmetternd war: „Biliäre Karzinome haben insgesamt eine sehr schlechte Prognose“, Heilung nur in Ausnahmefällen, hohes Rezidiv-Risiko, 5-Jahres-Überlebensrate bei einer verschwindend geringen Prozentzahl und so fort und so fort.
Das konnte doch alles nicht sein! Ich war 55 Jahre alt, hatte immer gesund gelebt, nie geraucht, Sport gemacht, hatte keine der in den Internet-Beiträgen genannten Risikofaktoren, stand mitten im Leben, die Kinder waren gerade aus dem Gröbsten raus, aber noch ohne Studienabschluss. Mein Mann und ich wollten doch zusammen alt werden, Großeltern werden, den Ruhestand genießen.
Bereits zwei Tage später hatte ich einen Vorstellungtermin beim Chef des Zentrums für Chirurgie an einer Universitätsklinik. Er sagte zu unserer großen Erleichterung, dass eine Operation möglich sei, und zwar in Form der Entfernung des linken Leberlappens. Wir hatten gar nicht zu hoffen gewagt, dass der Befund (noch) operabel ist. „Wann wollen Sie es machen lassen?“ „So schnell wie möglich. Weg mit dem Ding!“ „Morgen wird es nichts mehr.“ Nach mehreren Telefonaten wurde die ambulante OP-Vorbereitung mit Anästhesie-Gespräch etc. für den nächsten Tag festgelegt, die stationäre Aufnahme für den kommenden Montag, die OP für Dienstag. Die OP-Aufklärung erfolgte gleich vor Ort.
Der Anästhesist erklärte mir, dass man nach einer Hemihepatektomie (Entfernung der halben Leber) normalerweise eine Nacht auf der Intensivstation verbringe, dies aber wegen Corona-Lage nicht möglich sei, sodass man auf einer IMC-Station überwacht werde. Er empfehle das Legen eines Peridural-Katheters, damit man nach der Operation die Schmerzen gut bekämpfen und so auch schneller wieder mobil werden könne.
Am Montag ging es in die Klinik, wo ich bis abends nach 17 Uhr warten musste, bis ich endlich Zimmer und Bett beziehen konnte. Der Professor, der mich operieren sollte, hatte mir noch zur Anlage eines zentralen Venenkatheters (ZVK) in der OP geraten, was sich als sehr guter Rat erweisen sollte.
Am nächsten Morgen wurde ich um kurz nach 4 Uhr geweckt, nach dem Duschen und den weiteren Vorbereitungen ging es früh in den OP. Dort legten mir die Anästhesisten den Periduralkatheter, was ich mir deutlich schlimmer vorgestellt hatte. Und dann ging es auch schon in Morpheus‘ Reich. Aufgewacht bin ich mit mehrfachem heftigen Erbrechen, das aber schnell in den Griff gebracht werden konnte.
Nach einer sehr unruhigen, fast schlaflosen Nacht, da mindestens 8 Patienten in dem großen Zimmer lagen und ständig etwas los war, ging es im Laufe des Vormittags zurück auf Normalstation. Dank der Schmerzmedikation gelang die Mobilisierung recht gut.
Die Erholung in den nächsten Tagen ging schnell voran, Laufen auf dem Flur, Treppensteigen waren rasch wieder möglich. Freitags wurde der Blasenkatheter entfernt, samstags der Periduralkatheter. Nun waren für einige Stunden recht starke Schmerzen auszuhalten, bis die neue Schmerzmedikation wieder griff.
Am Montag ging es nach Hause, da mein Operateur meinte: „Gesund werden kann man nur zu Hause, nicht im Krankenhaus.“
Jeden Tag stand nun ein kleiner Spaziergang in Begleitung auf dem Programm, wobei der Radius stetig ein bisschen größer wurde.
Im Februar 2021 begann ich mit der mir empfohlenen adjuvanten Chemotherapie mit einem in Tablettenform einzunehmenden Präparat. Das Pathologie-Ergebnis des Tumors brachte ein optimales Ergebnis, die R0-Resektion war gelungen, es waren keine der untersuchten Lymphknoten befallen, ich hatte keine Metastasen. Die Hoffnung, dass die einzige Chance auf Heilung bei dieser Tumor-Art greifen würde, war groß.
Im Kontroll-MRT drei Monate nach der OP sah alles gut aus! Die Nebenwirkungen der Tabletten waren erträglich, wichtig war die einigermaßen zeitgleiche tägliche Einnahme morgens und abends, die sich aber leicht bewältigen ließ.
Im nächsten MRT nach weiteren drei Monaten war etwas in der Leber zu sehen, das aber möglicherweise auch Clips von der OP sein konnten. Mein Operateur meinte, ich solle mir keine Sorgen machen, das Pathologie-Ergebnis sei ja sehr gut gewesen mit relativ großem Resektionsrand. Wir sollten Urlaub machen, das Leben genießen.
Nach dem planmäßigen Ende der adjuvanten Chemotherapie nach gut 5 Monaten begann ich im Rahmen einer Wiedereingliederung wieder zu arbeiten, was mir sehr gut tat, da mein Beruf schon immer Berufung war. Ich machte Sport und fühlte mich wohl.
Neu waren lediglich Schmerzen im Rücken/linken Bein. Da meine Wirbelsäule aber bekanntermaßen degenerativ verändert ist, ich ähnliche Beschwerden bereits vor Jahren auf der rechten Seite gehabt hatte und meine sitzende berufliche Tätigkeit dem Ganzen sicher nicht zuträglich war, machte ich mir keine großen Gedanken.
Nach einem Urlaub stand die nächste Kontrolluntersuchung an. Der Radiologe eröffnete uns, dass es doch keine Clips, sondern ein Rezidiv im Resektionsrand sei. Um Lungenmetastasen auszuschließen, schlug er ein CT vor, was sofort gefahren wurde. Glücklicherweise war nichts Entsprechendes zu sehen. Im Herausgehen erwähnte mein Mann, dass ich in letzter Zeit verstärkt Rückenprobleme gehabt habe. Daraufhin sah sich der Radiologe die Bilder noch einmal an und entdeckte mehrere Knochenmetastasen beidseits in den Beckenknochen.
Damit war klar, dass die Hoffnung auf Heilung erloschen war, vielmehr befinde ich mich seitdem in einem palliativen Stadium. Dies bedeutet jedoch nicht, wie viele denken, Endstadium, Siechtum, Hospiz. Vielmehr sagt dieses Attribut, dass eine kurative Behandlung, eine Heilung nicht möglich ist, nur eine Linderung des Zustandes bei fortschreitender Erkrankung mit dem Ziel der Lebensverlängerung bei möglichst guter Lebensqualität. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort pallium ab, der Mantel/Decke bedeutet. Der schwerkranke Mensch soll also umhüllt, beschützt werden. Für dieses Stadium einer Erkrankung bürgert sich langsam auch der Begriff „chronisch“ ein, ähnlich wie bei Diabetes, Rheuma o.ä., da auch hier keine Heilung der Grunderkrankung möglich ist, aber dennoch eine relativ lange Lebenserwartung gegeben sein kann. Diese Bezeichnung ist mit weniger Schrecken assoziiert. Ich lebe nun immerhin schon über 16 Monate lang palliativ, und es geht mir weiterhin recht gut, ich bewältige den Alltag völlig selbständig!
Meine Ärztin riet mir „als Frau, nicht als Ärztin“, mit dem Arbeiten aufzuhören, nur noch das zu machen, worauf ich stressfrei Lust habe.
In der Woche nach der Rezidivfeststellung begann bereits die Chemotherapie. Außerdem wurden aus der Leber und den Knochenmetastasen Gewebsproben entnommen, um molekulargenetische Untersuchungen des Tumormaterials in die Wege zu leiten. Zudem hatte ich ein MRT des Schädels, mit dem Hirnmetastasen ausgeschlossen wurden, und mir wurde in einer ambulanten Operation ein Portkatheter implantiert. Eine ausgefüllte, sehr kräftezehrende Woche!
Aussagen zu einer Prognose waren und sind von den Ärzten – nachvollziehbarerweise – schwer zu bekommen. Eine Onkologin ließ sich immerhin zu der Einschätzung: „Jahrzehnte werden es nicht sein“ hinreißen.
Es folgten 10 Monate Chemotherapie, die ich relativ gut vertrug. Immer mal wieder musste die Dosis reduziert werden, damit die Blutzellen sich erholen konnten, aber vom Allgemeinbefinden her ging es mir meistens recht gut. Ich erhielt mehrere Bluttransfusionen.
Es waren sogar mehrere kleine Urlaube mit langen Spaziergängen, kleinen Wanderungen möglich!
In dieser Zeit wurden die Knochenmetastasen in 2 Zyklen bestrahlt.
Nachdem im August 2022 ein Progress festgestellt wurde, erhielt ich eine zielgerichtete Therapie mit einmal täglich einzunehmenden Tabletten, da bei mir eine entsprechende Mutation vorliegt. Nun begannen Monate mit hoher Lebensqualität. Ich begann sogar wieder, einige Stunden zu arbeiten, was mir sehr gut tat!
Leider musste diese Therapie nach 5 Monaten beendet und die Behandlung auf eine erneute Chemotherapie umgestellt werden.
Auch wenn klar ist, dass meine Erkrankung über kurz oder lang unweigerlich zum Tod führen wird, möchte ich Mut machen. Man kann trotz der Diagnose einer seltenen unheilbaren Erkrankung mit eingeschränkten Therapiemöglichkeiten viel Schönes, Wertvolles erleben.
Sterben müssen wir alle. Palliativpatienten haben das für alle sichere Ende natürlich viel bewusster und näher vor Augen. Dies birgt aber auch die Chance, Dinge zu regeln, sich auf Wesentliches zu konzentrieren, bestimmte Sachen bewusst zu machen. Ob man am oberen oder unteren Rand einer Statistik steht, weiß man nicht. Eine positive Grundeinstellung trotz aller Widrigkeiten ist unerlässlich, und so versuche ich, mich immer daran zu orientieren, dass alles noch viel schlimmer sein könnte – auch wenn das nicht immer gelingt.
Kraft schöpfe ich aus meiner Familie, Spaziergängen mit Freundinnen, dem Gefühl, vieles, was mit meinem Tod zusammenhängt, auf den Weg gebracht zu haben. Ich habe mein bisheriges Leben aufgeschrieben, Tondokumente aufgenommen. Wir machen Ausflüge, gehen in Museen, Theater, die Oper, schaffen weitere Erinnerungen. Ich setze nur auf die Schulmedizin, nehme keinerlei Nahrungsergänzungsmittel, Komplementär- oder Alternativpräparate.
Stefanie
(Name von der Redaktion geändert)
Februar 2023